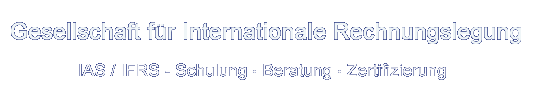Haushaltsgrundsätzemodernisierungsgesetz (HGrGMoG)
Das Haushaltsgrundsätzemodernisierungsgesetz liegt seit dem 17.12.2008 als Regierungsentwurf vor und wurde am 03.07.2009 vom Bundestag verabschiedet. Diese Reform sieht die „Doppik“ als vollwertiges System zur Haushaltsführung, neben der Kameralistik vor. Das Gesetz soll am 01.01.2010 in Kraft treten.
Einleitung
In Deutschland vollzieht sich seit einigen Jahren ein Paradigmenwechsel im öffentlichen Rechnungswesen. Das System der Kameralistik, welches auf Zahlungsgrößen basiert, wird in Anlehnung an die in der Privatwirtschaft verwendete ressourcenverbrauchsorientierte Rechnungslegung angepasst. Mittlerweile haben nahezu alle Bundesländer ihren Kommunen die doppelte Buchführung in Anlehnung an das deutsche Handelsrecht (HGB) vorgegeben. Allerdings haben die einzelnen Länder eigenständig und ohne Abstimmung untereinander die möglichen Gestaltungsspielräume unterschiedlich genutzt. Dies hat zur Folge, dass Jahresabschlüsse einzelner Kommunen aus verschiedenen Bundesländern kaum vergleichbar sind. Auch für die Kameralistik des Bundes hat der Bundesrechnungshof in seinem Bericht nach § 99 Bundeshaushaltsordnung (BHO) über die Modernisierung des staatlichen Haushalts- und Rechnungswesen Reformbedarf gesehen.[1] Vor dem Hintergrund der Initiativen der Länder Hamburg und Bremen[2] und der breiten Reformdebatte sind die Grundsätze für einheitlich rechtliche Rahmenbedingungen neu zu regeln.
Ziel
Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes ist es das wesentliche Ziel, „ eine Koexistenz unterschiedlicher Rechnungswesensysteme zu ermöglichen, innerhalb dieser Systeme jeweils ein Mindestmaß einheitlicher Vorgaben zu setzen und über die jeweiligen Gebietskörperschaften hinaus eine Einheitlichkeit der erforderlichen übergreifenden Datenlieferung zu gewährleisten.“[3] Zur Gewährleistung einer einheitlichen Verfahrens- und Datengrundlage jeweils für Kameralistik, Doppik und Produkthaushalte richten nach dem neu eingefügten §49 HGrGMOG Bund und Länder ein gemeinsames Gremium ein, das Standards so erstellt, „das die Anforderungen der Finanzstatistik einschließlich der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen berücksichtigt werden...“.
Wesentliche Gesetzesänderungen
Das HGrG beinhaltet wesentliche Grundsätze zur Gestaltung des Haushalts für Bund und Länder.
Eine wesentliche Änderung ist insbesondere die Einführung des § 1a HGrG n.F. Dieser eröffnet in Abs.1 ein Wahlrecht zwischen der Kameralistik und der Anwendung der „Grundsätze der staatlichen doppelten Buchführung“. Darüber hinaus wird in Abs. 2 ein Wahlrecht zur Gliederung des Haushalts eingeführt. Nach diesem darf die rechnungslegende Institution die Haushaltsführung nach Konten, Produktstrukturen und Titeln gestalten.
Bislang war die Kameralistik zwingend anzuwenden. Die doppelte Rechnungslegung hat erstmals 1997 Einzug ins HGrG gehalten. Allerdings ist der damals eingeführte § 33a HGrG nur als Zusatzinstrument zur Kameralistik eingeführt worden. Nach diesem darf neben der Kameralistik die Buchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung, in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch, erfolgen. Durch die Einführung des § 33 a HGrG war es allerdings möglich, dass reformbereite Bundesländer wie Hamburg, Hessen oder Nordrhein- Westfalen neben ihrer kameralen Rechnungslegung einen Jahresabschluss in Anlehnung an ein kaufmännisches Rechnungswesen gestalten. Trotz der Möglichkeit ein doppisches Rechnungswesen zu betreiben, sah das HGrG eine zwingende Anwendung der Kameralistik weiter vor. Mit dem HGrGMoG ist nur noch eines der beiden Rechnungslegungssysteme anzuwenden und ein Parallelbetrieb nicht mehr notwendig. Dadurch werden die reformbereiten Länder entlastet, die nun die Möglichkeit haben ihr kamerales System aufzugeben. Werden Reformvorhaben konkret umgesetzt, bedarf es gesonderter Beschlüsse und Überprüfungen der jeweiligen finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben und Haushaltsordnungen. Entscheidet sich eine Körperschaft für die Anwendung der doppelten Buchführung, so hat der Jahresabschluss gemäß § 37 Abs. 3 HGrG n.F. folgende Bestandteile: Erfolgsplan (Erfolgsrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Vermögensrechnung (Bilanz). Entscheidet sich dagegen eine Körperschaft für die Beibehaltung der Kameralistik, so ist weiterhin ein Haushaltsabschluss gemäß § 37 Abs. 2 HGrG und ein kassenmäßiger Abschluss § 39 HGrG aufzustellen.
Erstmals findet der Begriff „Grundsätze der staatlichen Doppik“ Eingang in den Gesetzestext. Der neue § 7a HGrG verweist dabei auf die Regelungen des HGB. Dieser Begriff ist neu. Bisher sprach man in der deutschsprachigen Literatur von „öffentlichen Rechnungslegungsstandards“ oder „Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung“. Da die für die Privatwirtschaft entwickelten Normen des HGB nicht eins zu eins übernommen werden können, gelten diese nur als Referenzmodell, welches um die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung ergänzt und erweitert werden müssen. Die technischen Einzelheiten (z.B. Ausgestaltung Verwaltungskontenrahmen, Integrierter Produktrahmen, Standards staatlicher Doppik) sollen nicht Bestandteil des Gesetzes werden, sondern vom Standardisierungsgremium gemäß § 49a Abs.1 HGrG n.F. erarbeitet werden.
Als alleiniges Referenzmodell soll dabei das HGB Grundlage für die staatliche Doppik sein, mit der Begründung, dass die IPSAS keine wesentlichen oder grundsätzlichen Unterschiede aufweisen würden. Ob diese Einschätzung zutreffend ist, bleibt abzuwarten. Betrachtet man z.B. die Vermögenserfassung und Bewertung, die insbesondere im öffentlichen Bereich als sehr komplex einzustufen ist, so ist fraglich ob sich nicht jetzt schon an die IPSAS orientiert werden soll, um eine spätere kostenintensive Umbewertung zu vermeiden. Auch dürften die Bestandteile eines IPSAS-Jahresabschlusses (Bilanz, Erfolgsrechnung, Veränderung des Nettovermögens, Geldflussrechnung und Anhang) wesentlich umfangreicher sein als die geplanten Bestandteile Erfolgs-, Finanzplan und Vermögensrechnung.
Die wachsende Bedeutung der IPSAS in und außerhalb Europas zeigt auf, dass diese sicherlich früher oder später auch in Deutschland eine bedeutende Rolle spielen werden und der jetzt beschrittene "deutsche Sonderweg" eher ein Holzweg denn Vorbild für den Rest der Welt sein dürfte.
[1] Bundesdrucksache 16/2400
[2] Bundesratsdrucksache 504/06
[3] Bundesdrucksache 16/12060
Grundprinzipien der Abschlusserstellung nach IPSAS
Im Folgenden finden Sie einige Grundprinzipien, die bei der Erstellung eines IPSAS-Abschlusses zu beachten sind:
Fair Presentation and Compliance with IPSAS/Vermittlung eines des tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes und Übereinstimmung mit den IPSAS (IPSAS 1.27ff)
Going Concern – d.h. Aufstellung des Abschlusses unter der Annahme, dass die berichtende Einheit fortgeführt wird (IPSAS 1.38ff)
Consistency/Darstellungsstetigkeit (IPSAS 1.42ff)
Materiality and Aggregation/Wesentlichkeit und Zusammenfassung von Posten (IPSAS 1.45ff)
Offsetting/Saldierung von Posten (IPSAS 1.48ff)
Comparative Information/Vergleichsinformationen (IPSAS 1.53ff)
Fehler aus Vorperioden sind über das Eigenkapital zu berichtigen und zu erläutern – die Vergleichszahlen im aktuellen Abschluss sind anzupassen (IPSAS 3.46ff)
Drohverlustrückstellungen (IPSAS 19.76ff)
Ein bei der Bilanzierung oftmals übersehener Bereich sind Drohverlustrückstellungen:
Drohverlustrückstellungen sind zu bilden, wenn so genannte „lästige“ Verträge (Onerous Contracts) vorliegen. Ein Vertrag ist „lästig“, wenn die zwingenden Kosten für die Vertragserfüllung den erwarteten Gewinn/Nutzen übersteigen.
Beispiel:
Die Stadt A hat für das Südbad zur Erweiterung der Liegewiese eine 10.000 qm große Fläche gepachtet – der Pachtvertrag läuft bis zum 31.12.09. Der Pachtzins beträgt EUR 25.000 pro Jahr und ist am Ende des Jahres zu entrichten.
Am 23.12.2006 beschließt der Rat der Stadt die Schließung des Südbades. Ein benachbarter Landwirt bietet der Stadt daraufhin an, die Fläche als Schafweide für EUR 5.000 pro Jahr zu pachten. Dies ist der ortsübliche Preis für landwirtschaftliche Pachtfläche. Zum 31.12.2006 bilanziert der Kämmerer diesen Sachverhalt wie folgt:
=> zwingende Kosten bis zum Ende des Pachtvertrages = EUR 75.000 (3 Jahrespachten a EUR 25.000)
=> Nutzen aus dem Pachtvertrag = EUR 15.000 (3 Jahresunterpachten a EUR 5.000) => drohender Verlust EUR 60.000
=> abgezinst mit einem Zinssatz von 6% = Rückstellung EUR 53.460
In diesem Fall ist die Basis für die Berechnung der Drohverlustrückstellung recht eindeutig - da monetär klar bemessbar. In vielen anderen Fällen sind Schätzungen der erwarteten Gewinne bzw. Nutzen notwendig. Dies bietet erheblichen bilanzpolitischen Spielraum.
Abschreibungen nach IPSAS
Im Folgenden finden Sie einige Kernpunkte zum Thema planmäßige Abschreibungen nach IPSAS.
Nutzungsdauer
Die Nutzungsdauer bestimmt sich nach der voraussichtlichen Nutzbarkeit für die berichtende Einheit. Die einheitsspezifische Nutzungsdauer eines Vermögenswertes kann demnach kürzer sein als seine wirtschaftliche Nutzungsdauer. IPSAS 17.73
Abschreibungsbeginn
Die Abschreibung beginnt, wenn sich der Vermögenswert in dem vom Management beabsichtigten, betriebsbereiten Zustand befindet. IPSAS 17.71
Restwert
Der Abschreibungsvolumen wird nach Abzug des am Ende der Nutzungsdauer erwartungsgemäß zu erzielendenden Betrages ermittelt, falls dieser wesentlich ist. IPSAS 17.69
Abschreibungsmethoden
Lineare Abschreibung, degressive Abschreibung, Leistungsabschreibungen sowie alle andere Methoden, die geeignet sind, das Abschreibungsvolumen eines Vermögenswertes systematisch über seine Nutzungsdauer zu verteilen. IPSAS 17.76ff
Besonderheiten
Rein steuerliche Abschreibungen (Sonderabschreibungen oder erhöhte Absetzungen) sind nach IPSAS nicht zulässig.
GWG-Abschreibungen sind über den Wesentlichkeitsgrundsatz in der Praxis i.d.R. vertretbar.
Komponentenansatz: Zerlegung eines Vermögenswertes in Einzelbestandteile für Abschreibungszwecke, wenn die Einzelbestandteile einen wesentlichen Teil der Anschaffungskosten des Vermögenswerts ausmachen und unterschiedliche Nutzungsdauern haben, z.B. Triebwerke, Bestuhlung und Rumpf bei einem Flugzeug. IPSAS 17.59ff
IPSAS im Jahrbuch Monitoring eGovernment & Verwaltungsmodernisierung
Im Oktober hat die Wegweiser GmbH das Jahrbuch Monitoring eGovernment & Verwaltungsmodernisierung veröffentlicht - im Kapitel "Öffentliche Haushalte - Reformen und Strategien" findet sich neben Beiträgen zum Thema Doppik auch ein Diskussionspapier mit der Überschrift "IPSAS die Zukunft des öffentlichen Rechnungswesens" Hier die Kernaussagen:
Während sich die Rechnungslegung im privaten Sektor immer mehr an einheitlichen Internationalen Standards ausrichtet, werden im öffentlichen Sektor derzeit mit viel Aufwand bundeslandspezifische Individuallösungen entwickelt. Die International Public Sector Accounting Standards kurz IPSAS fristen daher in Deutschland eher ein Schattendasein. Das ist insofern bedauerlich, als dass nicht nur internationale Organisationen wie EU und UNO ihre Rechnungslegung an den IPSAS orientieren – auch in vielen Staaten von Argentinien bis zu den USA wird mit oder an Regelungen gearbeitet, die den IPSAS entsprechen.
Die wesentlichen Vorteile der IPSAS gegenüber nationalen Doppiklösungen:
Kompatibilität mit der Privatwirtschaft - im nicht öffentlichen Bereich orientiert sich die Rechnungslegung wie erläutert zunehmend an den IFRS. Die Ausrichtung an ähnlichen Rechnungslegungsstandards ist angesichts der immer engeren Verknüpfung von privaten und öffentlichen Institutionen komplexitäts- und damit auch kostensenkend.
IPSAS machen darüber hinaus die Rechenwerke von öffentlichen Einrichtungen trotz aller Wahlmöglichkeiten international vergleichbarer als rein nationale Abschlüsse. Es werden Vergleichsdaten gewonnen, die dazu beitragen die Effizienz von nationalen Institutionen zu überprüfen. Internationale Vergleichbarkeit ist notwendig, um die Verwendung von Mitteln, die von internationalen Organisationen gewährt werden, nachzuweisen. Die Anwendung der IPSAS ist im Wettbewerb um diese Mittel im Übrigen dann hilfreich, wenn die mittelgebende Organisation ihr Rechnungswesen bereits an den IPSAS ausgerichtet hat.
Öffentliche Einrichtungen sind auf die Finanzierung durch Kredite und Anleihen angewiesen. Spektakuläre Zusammenbrüche wie in Argentinien haben gezeigt, dass auch öffentliche Institutionen zahlungsunfähig werden können. Kapitalgeber verlangen daher zuverlässige Informationen über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kreditnehmer. Letztlich heißt dies, dass sich auch öffentliche Institutionen vor der Vergabe von Fremdmitteln überprüfen lassen müssen. Investoren bevorzugen für dieses „Rating“ Daten, die internationalen Standards entsprechen.
Vor dem Hintergrund der Diskussion im Zusammenhang mit der Finanzierung des Landes Berlin - ist das Thema "Rating" für Öffentliche Einrichtungen und Gebietskörperschaften" wieder sehr aktuell geworden. Es bleibt abzuwarten, wann die ersten Kapitalgeber auch in Deutschland "IPSAS-konformer" Abschlüsse fordern.
Ralph Brinkhaus
IPSAS auf der 1. Hamburger Fachtagung zur Reform des staatlichen Rechnungswesens
Vom 2. bis zum 3. November 2005 fand die erste Hamburger Fachtagung zur Reform des staatlichen Rechnungswesens statt. Neben Referaten zur aktuellen Doppik-Umstellung wurde anlässlich eines Referates von Professor Schedler aus St. Gallen auch das Thema IPSAS intensiv diskutiert – dabei wurden von Schedler und den Diskussionsteilnehmern u.a. folgende Argumente für und gegen IPSAS genannt:
Pro:
IPSAS ist ein Ansatz zur internationalen Standardisierung des öffentlichen Rechnungswesens – die deutschen Modelle haben das Handelsgesetzbuch als Referenzmodell – bieten also keine internationale Vergleichbarkeit
IPSAS bevorzugt das Accrual Basis Accounting und stellt damit den im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit besonders wichtigen Ressourcenverbrauch dar
IPSAS verbessert die Transparenz des öffentlichen Rechnungswesens – Verpflichtung zum True and fair view
Contra:
IPSAS sind eher ein Reporting- als ein Accounting-Standard
IPSAS basieren auf den privatwirtschaftlichen IFRS - geben die Besonderheiten des öffentlichen Sektors daher nicht ausreichend wieder
IPSAS bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten den selben Sachverhalt unterschiedlich zu interpretieren und zu bilanzieren – eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse ist daher nicht gegeben
IPSAS basieren auf dem angelsächsischen Rechtsverständnis und sind daher für mitteleuropäische Rechtssysteme nur bedingt geeignet
IPSAS berücksichtigen insbesondere nicht die Besonderheiten des deutschen Rechtssystems
IPSAS werden von einer privaten Organisation herausgegeben – es fehlt also an der staatlichen Legitimität
Schedler plädierte in seinem Referat dafür, die IPSAS jeweils den landesspezifischen Besonderheiten anzupassen – eine direkte Übernahme ohne die Möglichkeit der Anpassung durch ein souveränes Gemeinwesen hält er für unmöglich.
Kommentierung durch den Herausgeber von www.ipsas.de
Viele Argumente die gegen IPSAS geäußert wurden sind sehr ernst zu nehmen, hierzu gehört auch die fehlende staatliche Legitimität. Ein Endorsement-Prozeß durch die Europäische Kommission (bei den IFRS mittlerweile Standard) ist leider noch nicht installiert worden. Die IPSAS sind im momentanen Bearbeitungsstand auch noch zu lückenhaft um vollständig als Referenzmodell für eine einzelstaatliche Regelung zu dienen.
Insgesamt muss aber festgestellt werden, dass viele dieser Kritikpunkte auch im Rahmen der Einführung der IAS/IFRS heftig diskutiert wurden. Am Ende dieses Prozesses steht nunmehr ein System, das auf internationaler Ebene hohe Akzeptanz gefunden hat. Die EU schreibt die IFRS mittlerweile für Konzernabschlüsse von kapitalmarktorientierten Unternehmen zwingend vor. Einzelne HGB-Regelungen wurden bereits in Richtung IFRS verändert. Die Vorteile von international einheitlichen Standards scheinen insgesamt doch bei weitem zu überwiegen. Deutsche Sonderwege sollten daher auch im öffentlichen Rechnungswesen möglichst vermieden werden. Es spricht vieles dafür, die IPSAS Regelungen schon bei der Einführung von doppischen Rechnungslegungssystemen zu berücksichtigen.
gfir.de